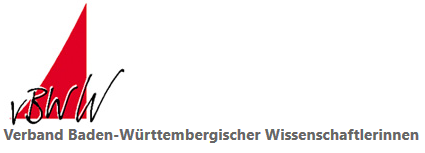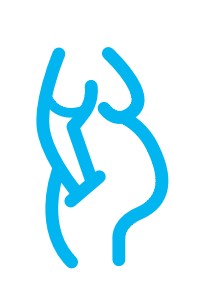Gleichstellungsbeauftragte
Gender in Lehre und Forschung
Gleichstellungsbeauftragte
"Frauen können zwar schlecht einparken, dafür aber gut zuhören. Bei Männern ist es umgekehrt."
Wenn Sie glauben, dass die Unterschiede in den Fähigkeiten des Einparkens und Zuhörens nicht ausschließlich biologisch begründet sind, dann spielt „Gender“ für Sie eine Rolle. Dieser Begriff steht für die soziale Zuschreibung wie Menschen unterschiedlichen Geschlechts sind oder sein sollen.
Eine gendergerechte Lehre reflektiert diese sozialen Zuschreibungen in der Planung und Durchführung von Lehrveranstaltungen. Alleine schon durch eine gendersensible Sprache können Frauen und Männer gleichermaßen angesprochen und geschlechtsbezogene soziale Diskriminierungen abgebaut werden. Eine gendergerechte Lehre bezieht sich jedoch auch auf die Inhalte, der Teilnehmendenorientierung, dem Verhalten während der Lehrveranstaltungen und der methodischen Gestaltung. So können unter anderem
- Themen aus Gender-Perspektiven aufgegriffen und reflektiert werden
- unterschiedliche Lebensrealitäten und Ausgangsbedingungen von männlichen und weiblichen Studierenden berücksichtigt werden
- geschlechtsbezogene Verhaltensmuster des Lehrenden reflektiert und vermieden werden
- in Arbeitsmaterialien Männer und Frauen gleichermaßen dargestellt werden
zur praktischen Umsetzung
Die Gender-Mediathek unterstützt die Suche nach feministischen und geschlechterbezogenen audiovisuellen Lehr- und Lernmaterialien. Sie ist ein kollaboratives Projekt vom Gunda-Werner-Institut, der Heinrich-Böll-Stiftung sowie den 16 Landesstiftungen der Heinrich-Böll-Stiftung.
Auf der Seite www.gender-curricula.com finden Sie Vorschläge, wie Sie Genderfragestellungen in die Curricula von Studiengängen integrieren können. Gerne können Sie auch Beispiele aus Ihrer Vorlesung an der HfWU an die Referentin für Gleichstellung und Familienfreundlichkeit schicken und damit anderen Lehrenden zur Veranschaulichung zur Verfügung stellen.
Genderrelevante Forschung beschäftigt sich mit Fragestellungen, die geschlechtsbezogen beschrieben und bewertet werden. Sowohl Lehrende als auch Studierende beschäftigen sich immer wieder mit genderrelevanten Forschungsfragen.
zur praktischen Umsetzung
Die HfWU vergibt jährlich den Preis für Abschlussarbeiten und Dissertationen in der Diversitäts- und Genderforschung. Damit werden qualitativ herausragend Arbeiten ausgezeichnet, die ein für die Geschlechter-, Gender- oder Diversitätsforschung relevantes Thema bearbeiten.
aktuelle Studien - Gender Bias
In regelmäßigen Abständen stellen wir aktuelle Studien zum Thema Gender Bias vor.
Den aktuellsten Eintrag finden Sie hier.
Alle Studien finden Sie hier.
zur Theorie
Da mit dem Begriff „Gender“ die soziale Zuschreibung von Geschlechterrollen reflektiert wird, spielt die Art und Weise der Kommunikation über Geschlechter und deren Rollen, eine zentrale Rolle in der Gleichstellung in Forschung und Lehre. Eine gendersensible Kommunikation kann deshalb einen Bewußtseinswandel bewirken, der die Gleichstellung von Männern und Frauen auch in anderen Bereichen hervorbringt. So legen Untersuchungen nahe, dass wir bei der Verwendung der männlichen Form in der Regel nur an männlichen Personen denken. Wenn aber zum Beispiel Berufe in einer gendersensiblen Sprache dargestellt werden – beispielsweise durch Nennung der weiblichen und männlichen Form („Ingenieurinnen und Ingenieure) – dann schätzen Schülerinnen jene Berufe, die traditionell als „Männerberufe“ angesehen werden, als erreichbarer ein und trauen sich eher selbst zu, diese zu erreichen. Die Sprache nimmt also Einfluss auf unser Denken und auf das Bild, das wir uns von der Wirklichkeit machen. Dasselbe gilt für Fotos und Abbildungen. Dabei soll darauf geachtet werden, dass keine bestehenden Stereotype gefestigt werden, stattdessen sollen beide Geschlechter gleichberechtigt dargestellt werden (z.B. auch in der Darstellung einer Pfarrerin oder eines Mannes, der Windeln wechselt).
zur praktischen Umsetzung
Diese Publikationen enthalten eine Fülle an Anregungen und Tipps, wie sie gendersensible Sprache korrekt und stilgerecht einsetzen können.
- respACT.pdf: Ein Leitfaden mit Sprachempfehlungen für geschlechtergerechte(re) Kommunikation an Hochschulen des Center for the Study of Language and Society (CSLS) der Universität Bern
- Empfehlungen zu einer gendergerechten Sprache
hrsg. von der LaKoG, 2021 - ÜberzeuGENDERe Sprache: Leitfaden für eine geschlechtersensible Sprache
hrsg. von der Gleichstellungsbeauftragten an der Uni zu Köln; 7. Aufl. 2021 - Rechtsgutachten zur geschlechtergerechten Amtssprache; Zusammenfassung
erstellt von Prof.in Dr.in Ulrike Lembke (Humboldt Universität Berlin) im Auftrag der Stadt Hannover; Dezember 2021 - Sie ist unser bester Mann - Wirklich? Tipps für eine geschlechtergerechte Sprache;
- hrsg. von der Ev. Kriche Deutschland (EKD) und dem Ev. Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.; Stand: April 2020
- Ausgesprochen vielfältig: Diversitätssensible Kommunikation in Sprache und Bild;
eine Handlungsempfehlung der Koordinierungsstelle zur Förderung der Chancengleichheit an sächsischen Universitäten und Hochschulen; 3. Aufl. 2018 - geschickt gendern - das Genderwörterbuch
konzipiert von Johanna Usinger - gendern.de - Wörterbuch für eine gendergerechte Sprache
ein Service von Woxikon.de
Gender-Sternchen *
Die Gleichstellungskommission hat am 17.04.2020 beschlossen, zukünftig in allen schriftlichen Dokumenten einheitlich das Gender-Sternchen zu verwenden. Damit ist eine wertschätzende und respektvolle Ansprache aller Geschlechter gewährleistet.
- Beispiele:
- Professor*in / Professor*innen
- Dozent*in / Dozent*innen
- Kolleg*in / Kolleg*innen
- Manager*in / Manager*innen
- Richter*in / Richter*innen