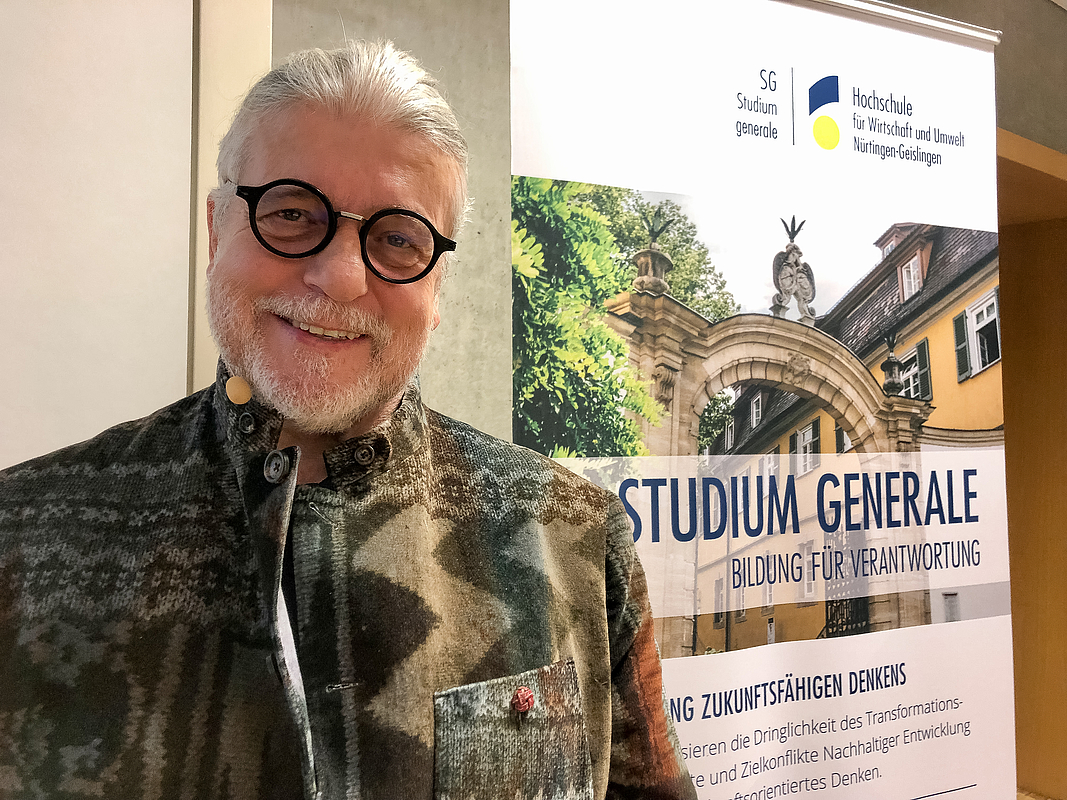GEISLINGEN (hfwu). Macht wird meist im Politischen verortet. Einen anderen Blick auf das Phänomen warf ein Vortrag im Studium generale der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU): Macht als menschliches Bedürfnis und komplexer Handlungszusammenhang, dessen kompetenten Umgang man lernen kann.
„Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht“, so die oft zitierte Definition von Max Weber, Gründervater der deutschen Soziologie. Ganz so einfach ist es nicht. So könnte die Erkenntnis lauten nach dem Vortrag von Prof. Dr. Rüdiger Reinhardt am Standort der HfWU in Geislingen (Steige). „Wir müssen genauer hinschauen, wie uns Macht verändert“, so der Studiendekan des Studiengangs Wirtschaftspsychologie. Das Interesse an der Veranstaltung im Studium generale der HfWU war groß. Rund fünfzig Zuhörer waren zu dem öffentlichen Vortrag gekommen.
Das Bedürfnis nach Macht, und damit andere beeinflussen zu können, hat sich evolutionär entwickelt, ist Reinhardt überzeugt. Denn Macht ausüben zu können, erhöhe die Überlebenswahrscheinlichkeit. Hier klingt bereits an, was der Psychologe den „Generalverdacht des Destruktiven“ nennt. Menschen setzten Macht aber nicht nur destruktiv, sondern auch konstruktiv ein. Ein weitere Kritikpunkt: Macht werde meist falsch erklärt. Machtausübung werde auf die Frage des Charakters reduziert. „Machtphänomene sind stets zwischenmenschlich“, hält Reinhardt dem entgegen. Entsprechend seien sie nicht als etwas nur Individuelles oder persönliche Ressource zu deuten.
Macht als grundlegendes menschliches Bedürfnis sei ansich neutral und so per se nicht ein Problem. Problematisch werde erst ein inkompetenter Umgang mit ihr. Ein kompetenter Umgang aber setze ein fundiertes Verständnis des vielschichtigen Phänomens voraus. In seinem komplexen Modell verschiedener Machtwirkungskreisläufe unterscheidet der Wissenschaftler zwischen persönlicher Macht und sozialer Macht. Erstere richtet sich auf den eigenen Erfolg und Sieg, ist eher impulsiv. Die soziale Macht dagegen nimmt andere und das Gemeinwohl in den Fokus, beinhaltet Verantwortung, moralisches Abwägen, Selbstkritik und bedenkt mögliche Konsequenzen des eigenen Handelns.
Neu in der Führungsposition starten Chefs oft mit einer ordentlichen Portion sozialer Macht. Ihnen ist bewusst, dass sie Verantwortung tragen für das Team und die ganze Organisation. Hinzukomme eine „demütige Unsicherheit“, der Umstand, dass Vertrauen erst verdient werden muss. Mit der Zeit könne es aber zu einem Kipppunkt kommen. Wenn sich die Waagschale zugunsten der persönlichen Macht senkt und etwa eigene Karriereinteressen in den Vordergrund geraten. Dann wird konstruktive zur destruktiven Macht. Wie die dahinterliegenden komplexen Prozesse funktionieren, welche „Regelkreise der Macht“ es gibt, diese Fragen gehören zu den Forschungsschwerpunkten von Reinhardt.
Die gute Nachricht und eine der Kernaussagen des Psychologen, Machtkompetenz lässt sich lernen. Konkret: lernen lasse sich, Machtressourcen zu durchschauen, diese strategisch flexibel zu nutzen, die Folgen daraus verantwortlich abzuwägen, die psychologischen Effekte von Macht zu regulieren und sie bewusst zu teilen, resilient mit persönlichen Kosten und Druck umgehen zu können und nicht zuletzt Macht im Zusammenspiel denken zu können.
Das unorthodoxe Verständnis von Macht als ein psycho-soziales Phänomen kam beim Publikum an. Im Anschluss an den Vortrag folgten zahlreiche Fragen und eine rege Diskussion.